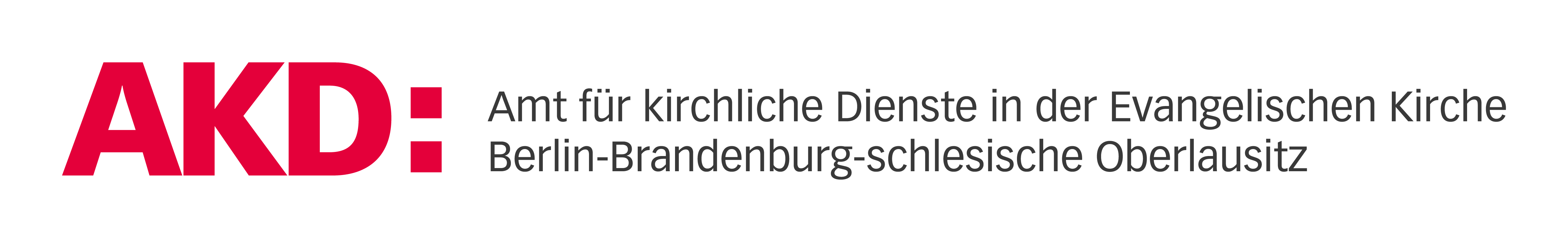Warum RU durch Pfarrer:innen?
Impuls zum Beginn des Vikariats
Es gibt für manche einen Befremdungseffekt, die Ausbildung mit einem religionspädagogischen Schwerpunkt zu beginnen. Soll ich jetzt Lehrer:in werden?
Aber an und für sich ist Schule kein ungewöhnlicherer Ort für Pfarrer:innen als etwa das Krankenhaus, die Studierendengemeinde, der Gottesdienst zum Erntefest mitten auf dem Feld auf einem Treckerhänger oder die Havel als Taufort. All dies sind Orte außerhalb der Mauern des Kirchgebäudes oder der Gemeinderäume, an denen sich pastorales Handeln vollzieht. Natürlich gibt es noch unendlich mehr solcher zweiten und dritten Orte pastoralen Handelns. Womöglich aber durch die besondere Stellung des RU in Berlin und auch in Brandenburg (völlig anders allerdings in der schlesischen Oberlausitz) wird beim Gespräch zum Bildungsort Schule oft nachgefragt: warum muss das sein?
Bildung ist wie Seelsorge, Gottesdienst oder Leitung eine der Grundaufgaben des Pfarrdienstes. Wie jede der Aufgaben im Pfarrdienst ist nicht festgelegt, an welchem Ort oder mit welcher Altersgruppe die Aufgabe wahrgenommen wird: dies ergibt sich in der Regel aus der Situation der Gemeinde heraus oder aus dem besonderen Zuschnitt der Parochien: die eine Kollegin geht regelmäßig in das Altersheim, die andere übernimmt die Glaubenskurse. Damit setzt die eine einen Schwerpunkt in der Seelsorge, die andere in der Bildungsarbeit mit Erwachsenen.
Insofern stellt Religionsunterricht absolut keine besondere Aufgabe im Pfarrdienst dar. Er ist wie Konfirmandenunterricht, Elementarpädagogik, Bildungsarbeit mit Familien, Jugendlichen oder Senior:innen reguläre pastorale Bildungsarbeit. Das intensive Lernen in der Religionspädagogik hat zudem den Charme, Fähigkeiten zu erwerben und Methoden kennenzulernen, die in alle andere Bildungsaufgaben sowieso, aber auch darüber hinaus – sogar für die gottesdienstliche Arbeit – ausstrahlen und von erheblichem Nutzen sind. Es bietet gewissermaßen erhebliches Transferpotential: wie später übrigens dann auch die Seelsorgeausbildung nach KSA, deren Lerneffekte ganz gewiss nicht auf den Raum der seelsorglichen Begegnung begrenzt sind, sondern weit darüber hinaus reichen.
Nun ist der Ort Schule betrachtet aus den Augen einer:s Gemeindepfarrer:in durchaus herausfordernd. Schule und Gemeinde stellen zwei komplett andere Systeme dar. Das beginnt schon bei der rechtlichen Aufhängung: Die Arbeit in der Gemeinde unterliegt kirchlichem Recht, in der Schule staatlichem Recht. Dabei hat der RU eine interessante Zwitterstellung – wie übrigens auch die theologischen Fakultäten zählt er zu den sog. „res mixta“, den Feldern, die von Kirche und Staat gemeinsam verantwortet werden. Das steht im GG, Artikel 7: „Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates.“, lautet Satz 1. Zum RU heißt es dann weiter: „Unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechts wird der Religionsunterricht in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt.“, sprich: für die Inhalte und das Personal sorgen die Religionsgemeinschaften, im evangelischen RU also die evangelische Kirche. So ist zum Beispiel der Lehrplan kirchlich erstellt, aber staatlich verantwortet: er muss sich also am staatlichen Rahmenlehrplan orientieren und Religionslehrkräfte können nicht unterhalb staatlicher Anforderungen ausgebildet werden.
Atmosphärisch muss man wohl noch ergänzen, dass die Erkenntnis, dass es sich bei der Ausgestaltung der res mixta nicht um einen Gegensatz von Kirche und Staat handelt, gerade in Folge der Erfahrungen von Christinnen und Christen in der DDR eine durchaus schwere Lerngeschichte gewesen ist.
Der Ort Schule (wie übrigens alle Orte der Spezialseelsorge ebenfalls: Krankenhaus, Altenpflegeheim, Gefängnis, Universität, usw.) und der Ort Kirchengemeinde sind zwei unterschiedliche Systeme. Und da kann es durchaus zu Kollisionen kommen. Das gilt besonders dann, wenn Pfarrer:innen nur wenige Stunden in den Unterricht und also in das System Schule eingebunden sind, und so zum einen reguläre Aufgaben von Personen an der Schule (wie Vertretungen, Aufsichten, Konferenzen, kollegiale Anbindung, Schulfahrten, Seelsorge bei MA) schwer zu realisieren sind. Zum anderen können im Pfarrdienst unvermittelt nötige Gespräche und Termine auftreten – Stichwort Beerdigung, wenn etwa Bestattungsfirmen diese mitten in der Zeit ansetzen, in der ein Pfarrer RU zu erteilen hätte – die dann unmöglich zu vermitteln sind. Das sind natürlich Ausnahmen, doch potentiell bleiben solche Herausforderungen bestehen; aber natürlich gibt es auch dafür Formen des RU (Stichwort: RU in Projektform), die die Kollision beider Systeme besser eingrenzen können.
Im Verhältnis zu diesen operativen Risiken sind die Chancen des Religionsunterrichts enorm:
- Der Ort Schule bietet die breitestmögliche Begegnungsfläche mit Kindern und Jugendlichen in der Gesellschaft – natürlich auch für jene, die kirchlich keinen Anschluss haben: und das sind immer mehr!
- In der Schule kommen alle Milieus zusammen.
- Außerhalb von Familie und der Kirchengemeinde ist die Schule der wichtigste Ort für religiöse Bildung.
- Der RU bietet einen Raum, an dem in einem akzeptierten Klima über Religion und religiöse Fragen gesprochen werden kann. Der RU fordert und fördert elementare Kommunikation von Glaubenshaltung, -fragen und –ansichten.
- Der Ort Schule stellt für viele Kinder und Jugendlichen die einzige realistische Möglichkeit für eine Begegnung mit Kirche und Glaubensfragen dar.
- Es bestehen insbesondere im ländlichen Raum durchaus Schnittmengen zur gemeindlichen Kinder- und Jugendarbeit.
- Für solche Kinder und Jugendliche, die sich zur Gemeinde halten, stellt die Präsenz von Pfarrer:innen an der Schule und ihr RU auch einen Plausibilitätsraum dar, sich nicht als „randständig“ empfinden zu müssen.
- Der Unterricht von Pfarrer:innen an der Schule ein wichtiges Zeichen für ein Miteinander von Kirche und Schule und fördert dieses.
- Pfarrer:innen an Schulen sind für manche Schulleitungen attraktive Lehrkräfte mit Blick auf den seelsorglich-sozialen „Mehrwert“, da sie die theologische und seelsorgliche Präsenz an Schulen stärken.
Sie ahnen: hier ließe sich manches und mehr sagen. In der alle zehn Jahre neu erhobenen KMU (KMU VI.) wird gerade dieser Zusammenhang noch einmal deutlich hervorgehoben und die Bedeutung des RU als zentrale und zukunftsträchtige kirchliche Bildungsaufgabe am Ort Schule unterstrichen.
Sie werden diesen Schwenk weg von der Konzentration auf die Parochie hin auf die gesellschaftlichen Orte, an denen Kirche mit ihrem Angebot präsent ist und präsent sein wird, erleben und gestalten. Dabei ist der RU für die Begegnung mit Kindern und Jugendlichen erste Wahl!
OKR Dr. Christoph Vogel
Religionspädagogisches Vikariat (RPV)
September 2025 bis Februar 2026
Materialien zur Vorbereitung
Allgemeine Informationen zum RPV für Vikar:innen
Links zum Start ins RPV
Literatur- und Materialempfehlungen
Einen guten Überblick über die Bildungsarbeit unserer Landeskirche in Schule und Gemeinde gibt das Bildungskonzept der EKBO aus dem Jahr 2017: Bestandsaufnahme, Klärungen und Empfehlungen.
Bildungskonzept der EKBO „frei & mutig“
Ansprechpersonen
Dr. Margit Herfarth, Studienleitung Religionspädagogik
+49 151 2107 8676|m.herfarth@akd-ekbo.de
Christoph Kilian, Studienleitung Religionspädagogik
+49 160 3356 148|c.kilian@akd-ekbo.de
Sekretariat Religionspädagogik
Melanie Gerónimo
+49 30 3191 278|+49 151 4238 6448|m.geronimo@akd-ekbo.de