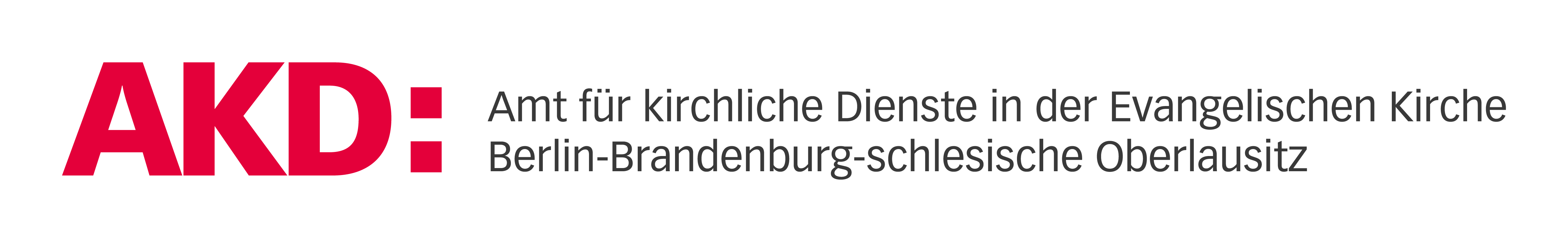Aktualisiert am 15.12.2021
Bericht „Frauen reden zu Tisch“ am 11. März 2021
Kann frau Hausfrau sein und gleichzeitig Feministin? Diese Frage wurde bei der Online-Veranstaltung „Gleichberechtigung in der Krise: Frauen, Feminismus und die Lehren der Corona-Pandemie“ am 11. März 2021 diskutiert. Rund 250 Frauen nahmen an der Veranstaltung der Reihe „Frauen reden zu Tisch“ teil.
Hat die Corona-Pandemie zur ‚Retraditionalisierung‘ von Geschlechterrollen geführt? – Diese Frage stand im Mittelpunkt der Diskussion, bei der aktuelle Forschungsergebnisse und soziologische Einordnungen einflossen. Eingeladen hatte das interreligiöse Frauenmahl-Team: die Evangelische Akademie zu Berlin, das Amt für kirchliche Dienste in der EKBO, das Aktionsbündnis muslimischer Frauen, das Deutsche Muslimische Zentrum und das jüdisch-feministische Netzwerk Bet Debora.

© Foto Globisch: P. Kunz / Foto Hipp: David Ausserhofer / Foto Sahebi: Hannes Leitlein
Den Auftakt machten zwei ausgewiesene Soziologinnen: Prof. Dr. Lena Hipp, Leiterin der Forschungsgruppe Arbeit und Fürsorge am Wissenschaftszentrum Berlin, und Dr. Claudia Globisch, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg. Sie wiesen anhand statistischer Erhebungen aus dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 in Familien mit gemischtgeschlechtlichen Eltern nach, dass der Anteil der von Männern übernommenen Kinderbetreuung und Hausarbeit für einen begrenzten Zeitraum zunahm, Frauen aber nach wie vor den größeren Teil übernahmen. Neuste Daten deuteten allerdings darauf hin, dass dieser Trend ab dem zweiten Halbjahr 2020 schon wieder rückläufig sei. Während sich bei Frauen in unteren Lohngruppen die Gefahr einer Rückkehr in die Zuverdienerinnenrolle abzeichne, betonten die beiden Expertinnen, dass sie derzeit nicht pauschal von einer „Retraditionalisierung“ sprechen könnten. Auch die längerfristigen Entwicklungen müssten noch genau untersucht werden.
Die Journalistin, Politikwissenschaftlerin und Ärztin Gilda Sahebi griff anschließend die vielfach diskutierte Frage auf, inwieweit die Entscheidung von Frauen, sich zumindest zeitweise ausschließlich Familie und Haushalt zu widmen, auch freiwillig – und feministisch – sein kann. Sie hielt ein starkes Plädoyer dafür, dass Feministinnen die freie Wahl aller Frauen anerkennen und fördern müssten: „Ich glaube, ein Grundstein des Feminismus ist Solidarität. Solidarität für die freiwillige Entscheidung jeder Frau so zu leben, wie sie es möchte. Solidarität für die Frauen, die keine Entscheidungsmöglichkeiten, keine Wahlfreiheit haben. Und damit verbunden unsere aller Anstrengungen für eine Gesellschaft zu kämpfen, in der Frauen wählen können, wie sie leben wollen […]. Wir brauchen vor allem Solidarität in der Krise: Das beginnt bei einer besseren Bezahlung von Care-Arbeit, besserer finanzieller und struktureller Unterstützung von Alleinerziehenden und vielen anderen Maßnahmen.“
Im Chat und in Gesprächsgruppen im zweiten Teil der Veranstaltung wurde Gilda Sahebis Plädoyer intergenerationell kontrovers diskutiert: Unterschätzten junge Frauen heute die Gefahren der Abhängigkeit und Altersarmut? Müsse berufliche Eigenständigkeit nicht immer Priorität haben? So lauteten einige der vorgebrachten Bedenken. Mit Blick auf die Corona-Krise äußerten viele Teilnehmerinnen ihre Ungeduld gegenüber notwendigen politischen und gesellschaftlichen Veränderungen. Die Erschöpfung vieler Frauen und Familien nach einem Jahr der Pandemie warf drängende Fragen nach bestehenden strukturellen Ungleichheiten auf: Wie kann es sein, dass vorrangig von Frauen geleistete Care-Arbeit im Beruflichen wie im Privaten auch 2021 weder finanziell noch gesellschaftlich adäquat honoriert wird? Ist die Kleinfamilie überhaupt noch zukunftsträchtig, um Beruf und Familie zu vereinbaren? Welche neuen Arbeitszeitmodelle werden gebraucht?
Eines wurde im Laufe der Veranstaltung immer wieder deutlich: Um die Problemlage umfassend analysieren und daraus politische Forderungen ableiten zu können, ist eine intersektionale Perspektive unbedingt nötig. Dabei muss das Augenmerk – wissenschaftlich, politisch und zivilgesellschaftlich – verstärkt auf diverse Lebensformen gerichtet werden wie Alleinlebende und Alleinerziehende, LGBTIQ und auf damit verschränkte Diskriminierungskategorien wie Gesundheit und Behinderung, (zugeschriebene) Herkunft und Ethnizität, religiöse Identität, Bildung und Klasse. In diesem Sinne brachte Gilda Sahebi ihr inklusives Verständnis von feministischer Solidarität auf den Punkt: „Solidarität im intersektionalen Sinne gehört übrigens auch zum Feminismus, und zwar uneingeschränkt.“

Den Input von Gilda Sahebi können Sie hier in ganzer Länge nachlesen (PDF, ca. 150 KB)