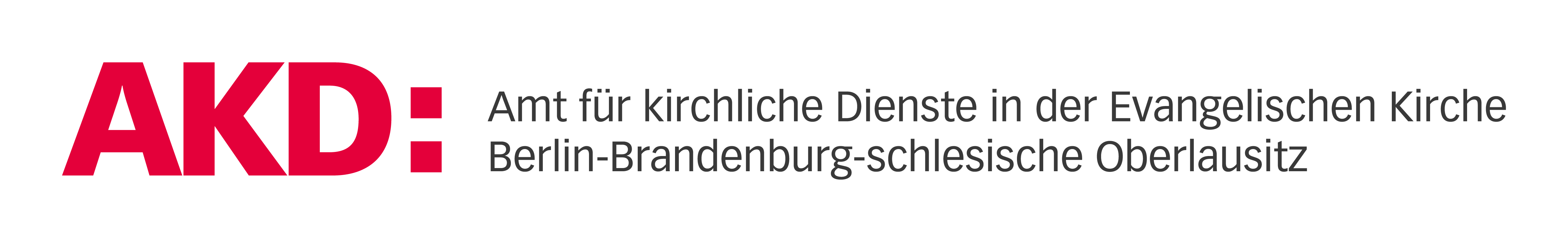Parität • Sexuelle Selbstbestimmung • Geschlechtergerechte Sprache • Haltung zeigen – rote Linien ziehen • Religiöse Selbstbestimmung
Der Vorstand der Frauen in der EKBO hat der Frauenversammlung im Jahr 2021 (13. Februar) Positionsbestimmungen vorgeschlagen. Diese wurden in der Online-Versammlung vorgestellt, in Kleingruppen wurden die jeweiligen Themen diskutiert. Die Positionierungen wurden von der Frauenversammlung in ihren Grundlinien bestätigt. Auf der Grundlage der Diskussionen wurden die Formulierungen an einigen Stellen verändert. Im Folgenden finden Sie diese Positionen, die als momentane Beiträge zu verstehen sind und der weiteren Diskussion dienen sollen.
Parität in der EKBO
Die Frauen in der EKBO haben das Ziel, dass alle kirchlichen Gremien und Ämter – sowohl im beruflichen als auch im ehrenamtlichen Bereich – paritätisch besetzt sind.
Maßnahmen:
- Dem Kirchengesetz zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern in der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz von 2003 (Gleichstellungsgesetz – GIG) entsprechend und vergleichbar mit dem Kirchengesetz zur geschlechtergerechten Besetzung von Gremien der Evangelischen Kirche in Deutschland (Gremienbesetzungsgesetz – GBG-EKD) vom 13. November 2013 soll ein Gesetz oder eine Umsetzungsbestimmung für die EKBO geschaffen werden. Die entsprechenden Gesetze der EKBO, wie z. B. das Synodengesetz müssen angepasst werden.
- Kirchenleitende Personen und Gremien in Landessynode, Kirchenleitung und Konsistorium geben regelmäßig Auskunft über die Fortschritte bei der paritätischen Besetzung von Synoden und deren Gremien, Ausschüssen, Kammern, Kommissionen, Verwaltungs- und Aufsichtsräten, Beiräten und vergleichbaren Gremien der EKBO.
- Flankierend zu den Wahlverfahren sollen für Frauen und Männer, die in der Kirche ehrenamtlich oder beruflich Dienste wahrnehmen individuelle Maßnahmen, wie z. B. Mentoring-Programme und eine bessere Vereinbarung von Beruf und Familie, gefördert werden.
- Alle Gremien und Ämter der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz sind über die Zielsetzung Parität zu informieren.
Keine Kriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs
Die Frauen in der EKBO setzen sich dafür ein, dass die Paragrafen 218/219a aus dem Strafgesetzbuch (StGB) gestrichen werden. Schwangerschaftsabbruch darf nicht durch die Verortung im Strafgesetzbuch kriminalisiert werden. Schwangerschaftsabbruch sollte – wie andere Fragen der Medizin auch – mit garantierter Kostenübernahme im Recht der medizinischen Dienstleistungen geregelt sein, sowie zum Beispiel in Gesetzen zu Sexualität, Familienplanung und Schwangerschaftsabbruch. Gleichzeitig muss Schwangerschaftskonfliktberatung zur Pflichtversorgung gehören und finanziell abgesichert werden.
In entsprechenden Gesetzen könnten Regelungen, die einer Fristenlösung entsprechen, verankert werden und auch ein kostenloses Beratungsangebot und der Zugang zu Verhütungsmitteln.
Auf diese Weise würde dann geregelt werden, unter welchen Umständen ein Schwangerschaftsabbruch vorgenommen wird.
Wir sind der Überzeugung, dass das ungeborene Leben nicht gegen, sondern nur mit der schwangeren Frau geschützt werden kann. Dafür muss flächendeckend Beratung im Schwangerschaftskonflikt und nach einem Abbruch gewährleistet sein. Diese könnte den Regelungen des derzeitigen Schwangerschaftskonfliktgesetzes (SchKG) entsprechen.
Abtreibungen gegen den Willen der Schwangeren sollten dagegen strafbar bleiben.
Geschlechtergerechte Sprache weiter denken
Sprache bildet Wirklichkeit nicht nur einfach ab, sondern prägt sie auch. Der Gender*Stern geht über die Frage der gleichberechtigten Darstellung von Männern und Frauen hinaus. Mit dem Einfügen des Sterns (oder auch eines Doppelpunkts), werden auch diejenigen einbezogen, die sich nicht in eine Zweigeschlechterordnung einordnen.
Durch Sprache wird nicht nur das binäre Geschlechtersystem mit seinen heteronormativen Implikationen (re-)produziert. Vielmehr ist dieses stets eingebunden in weitere Machtverhältnisse, die zu menschenunwürdigem Leben und in eine ökologische Katastrophe führen. Um Gewalt abzubauen, nehmen wir eine intersektionale Perspektive ein, die „Geschlecht“ zugleich mit den Kategorien und Zuschreibungen oder Zugehörigkeiten wie „Klasse“, „Nation“, „Ethnie“, „Race“, „körperliche Befähigung“ und „Religion“ betrachtet. „Der Genderstern ist ein vielfältiger Gerechtigkeitsstern“.
Haltung zeigen – rote Linien ziehen
Die Frauenversammlung der EKBO begrüßt den Gesprächsimpuls „Haltung zeigen“ der Landessynode der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (Frühjahrssynode 2019)
Insbesondere den Abschnitt „Miteinander in Vielfalt“:
„Wir nehmen wahr, dass sich völkisches und rassistisches Denken, Reden und Handeln auch in unserem Land ausbreitet. Menschen und Menschengruppen werden wegen ihres Geschlechts, ihrer sexuellen Orientierung, ihrer religiösen und kulturellen Herkunft oder wegen körperlicher, geistiger und seelischer Einschränkungen abgewertet und ausgegrenzt. Zunehmend werden Menschen durch Sprache, Haltungen und Taten erniedrigt und verletzt. Wir glauben an die versöhnende und befreiende Botschaft der Liebe, in der Christus uns begegnet. Jeder Mensch ist vor Gott einmalig. Individualität und Vielfalt der Gaben sind Ausdruck der Gnade Gottes. Alle Menschen sind dazu gerufen, den Wert menschlichen Lebens zu achten, ein menschenwürdiges Miteinander zu gestalten und insbesondere den Schwächeren beizustehen. Wir stellen uns schützend und öffentlich hörbar und sichtbar vor Menschen, die Ausgrenzung und diskriminierenden Erfahrungen, verbaler oder tätlicher Gewalt ausgesetzt sind. Wir öffnen unsere Räume für Menschen in Not. Wir ermutigen zum Widerstand gegen menschenverachtendes Reden und Handeln. Jede Form von Antisemitismus ist und bleibt unvereinbar mit dem biblischen Zeugnis und dem christlichen Glauben. Wir unterstützen alle, die sich gegen Verachtung und Diskriminierung anderer einsetzen und beteiligen uns an Netzwerken zur Stärkung von Zivilcourage.“
Wir Frauen in der EKBO fügen hinzu:
Wir nehmen wahr, dass in Gruppen, Projekten und Veranstaltungen der Frauenarbeit immer wieder Meinungen geäußert, Haltungen gezeigt bzw. verbale Angriffe getätigt werden, die dem von uns vertretenden Menschenbild widersprechen.
Wir stellen uns schützend auf die Seite der Schutzsuchenden, vor Menschen die ausgegrenzt werden, die Anfeindungen und Bedrohungen ausgesetzt sind, weil sie vermeintlich „anders“ sind. Wir bieten Ihnen in unseren Räumen Schutz und signalisieren das deutlich nach außen und innen.
Wir geben unsere Haltung klar zur Kenntnis.
Wir beenden ein Gespräch, wenn es keine Aussicht auf einen Konsens gibt.
Wir berufen uns auf unser Hausrecht.
Wir ermutigen insbesondere Frauen, sich Hilfe und Unterstützung zu suchen und vermitteln dafür Kontakte zu Netzwerkpartnerinnen.
Religiöse Selbstbestimmung
Für uns als evangelische Christ*innen ist Freiheit – und damit auch und gerade Religionsfreiheit – ein zentraler Wert und die Richtschnur unseres kirchlichen und gesellschaftlichen Denkens und Handelns. Konkret bedeutet das für uns auch, uns gegen jede Form von Zwang zu wenden und Menschen darin zu unterstützen und zu stärken, dies ihrerseits zu tun. Als Teil der Frauenbewegung stehen wir für Empowerment und Emanzipation von Frauen.
Das erzwungene Tragen eines Kopftuchs lehnen wir ab.
Ein generelles gesetzliches Verbot – auch und erst Recht für Minderjährige – lehnen wir jedoch ebenso entschieden ab.
Wir lehnen ab, dass muslimische Mädchen und Frauen, die ein Kopftuch tragen, diskriminiert werden, beispielsweise bei der freien Berufswahl, dass sie öffentlich beleidigt oder sogar mit Gewalt angegangen werden.
Begründung:
- Religionsfreiheit ist ein Menschenrecht
- Die weltanschauliche Neutralität des Staates garantiert die gleiche Religionsfreiheit für alle.
- Es gibt keinen verfassungsrechtlichen Anspruch darauf, „von der Wahrnehmung anderer religiöser oder weltanschaulicher Bekenntnisse verschont zu bleiben“. (Bundesverfassungsgericht)
- Religion ist keine Privatsache: ausgeübte Religion in der Öffentlichkeit fordert vielmehr heraus, selber sprachfähig zu werden. Oft werden dagegen eigene begrenzte (religiöse) Sprachfähigkeit, eigene Ohnmachtserfahrungen zu Ablehnung gegenüber als „anders“ definierten Menschen.
- Es gehört zu den Errungenschaften einer freien Gesellschaft, dass der Staat keine Kleidervorschriften erlässt.
- Für viele Muslim*innen gehört das Kopftuch zu ihrem (religiösen) Subjektsein, wie jede Person wollen sie nicht auf ihre Kleidung reduziert werden. Ein Perspektivwechsel, der sie nicht ausschließlich als „unterdrückte Opfer“ wahrnimmt, ist nötig.
- Auch auf erzwungenes Tragen eines Kopftuchs ist ein „kulturelles“ oder gar gesetzliches Kopftuchverbot keine Antwort.
- Ein solches Verbot träfe zunächst einmal nicht diejenigen, die den Zwang ausüben, sondern die Mädchen und Frauen selber. Sie sollten durch niedrigschwellige Angebote der Beratung und Begleitung gestärkt, statt in die Isolation getrieben werden.
Wir schließen uns damit dem Positionspapier der Evangelischen Frauen in Deutschland von 2018 an.