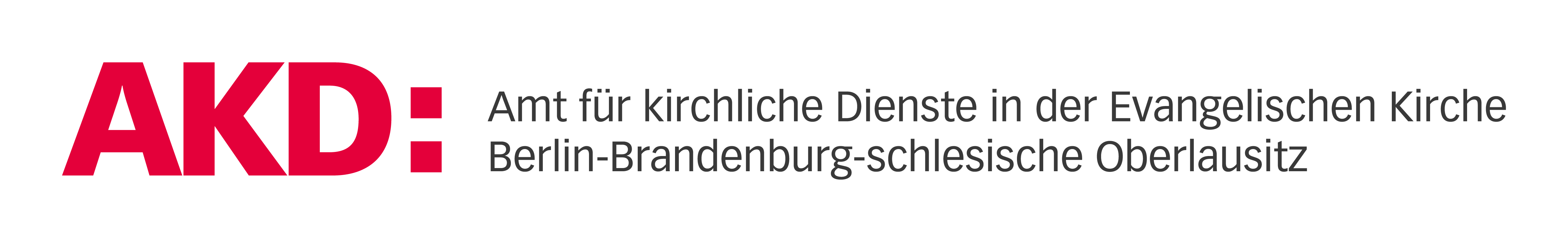In einem Arbeitsbericht könnten wir darüber schreiben, welche konkreten Projekte und Arbeitsvorhaben wir in den vergangenen zwei Jahren durchgeführt haben. Wir aber haben uns für einen anderen Weg entschieden. Wir treten einen Schritt zur Seite und blicken auf das Ganze, auf das, was Arbeit insgesamt für uns bedeutet, wie sie uns und unseren Alltag prägt. Entstanden ist so ein kollegiales Schreibgespräch zwischen Charlottenburg und Brandenburg an der Havel. Ein Gespräch über die Arbeit.
Margit Herfarth (MH): Beide haben wir am Rande einer Studienleitenden-Konferenz den gleichen Impuls verspürt: Es ist an der Zeit, dass wir einmal grundsätzlich über unsere Arbeit nachdenken und nicht nur über einzelne, konkrete Arbeitsprojekte. Welche Motive und Intentionen schwingen mit, wenn wir arbeiten? Ist es relevant, dass wir für die Kirche arbeiten – oder würden wir an jedem beliebigen anderen Arbeitsplatz ähnlich denken, fühlen und handeln? Was fällt dir ein, wenn du über »Arbeit« nachdenkst?
Ulrike Mosch (UM): Wo fängt denn »Arbeit« eigentlich an, frage ich mich? Wo hört sie – jemals – auf? Und wer wären wir – ohne Arbeit?
Ich denke an manche Mittagspause auf den Touren mit Jugendlichen – beim Segeln, Paddeln, Radeln. Der Himmel ist blau, die Sonne strahlt und es ist Frieden. Und dann sage ich: »Ist das nicht herrlich? DAS ist meine Arbeit! Augen auf bei der Berufswahl!« Solche und ganz andere Augenblicke, in denen ich ganz in Übereinstimmung bin mit dem, was ich tue. Natürlich fühlen sich mitnichten alle Arbeitsmomente so an, aber etwas in mir wehrt sich gegen die Vorstellung, Arbeit wäre erst Arbeit, wenn sie anstrengt, stresst, weh tut – und alles andere wäre Vergnügen. Darf Arbeit Spaß machen? Oder ist es dann keine Arbeit? Wie denkst du darüber?
MH: Natürlich darf Arbeit Spaß machen! Natürlich? Nun komme ich doch ins Stocken. Ja, auch ich mag meine Arbeit (wenn es nicht so vollmundig klingen würde, würde ich sogar manchmal sagen: Ich liebe meine Arbeit) und fühle mich sehr beschenkt dadurch, dass ich eine Arbeit habe, bei der das möglich ist: sie gerne zu tun, mit Leidenschaft, mit Flow-Erfahrungen. Aber ich merke auch, dass ich von der berühmten protestantischen Arbeitsethik geprägt bin: Arbeit als unhinterfragbare Pflicht und Mittelpunkt des Lebens, gottgewollter Lebenszweck und möglichst gut zu verrichten. Das klingt ernst und schwer – und ich höre die Stimmen meiner Eltern und Großeltern, die mir ein grundsätzliches Misstrauen gegen zu viel Vergnügen mitgegeben haben. Manchmal muss ich mir das also selbst deutlich sagen (oder es mir von dir sagen lassen): ja, Arbeit darf Spaß machen. Auch ein Text, der sich leicht schreibt, kann unter Umständen ein guter Text werden. Nicht für alles muss man mit Stress bezahlen – es darf sich auch frei, unbeschwert und vergnüglich anfühlen. Arbeit und Vergnügen müssen keine Gegensätze sein.
Nachdenken möchte ich nun aber auch noch über deinen Satz ganz oben: Wer wären wir – ohne Arbeit? Wie hängt das »Ich«, die Identität, mit der Arbeit zusammen? Ich bin gespannt auf deine Gedanken!
UM: Dorothee Sölle schreibt in einem noch heute sehr lesenswerten Buch , Arbeit sei ein »Wesenselement menschlichen Lebens« – als solches schon erkennbar in der Erzählung vom Paradies. Wenn das so ist, dann gehört Arbeit zum Kern des Menschseins, sind wir also ohne Arbeit nicht zu denken. Allerdings geht es hier um gute, nichtentfremdete Arbeit (und das muss keine Lohnarbeit sein!), die dadurch gekennzeichnet ist, dass ich mich mit dem Ergebnis meiner Arbeit identifizieren kann, dass diese Arbeit selbstverantwortet und im Einklang mit meinem Lebensrhythmus getan werden kann, und dass ich in Beziehung stehe mit meinem Umfeld, mit Mit-Arbeitenden.
Arbeit wird also geprägt durch mein »Ich«, aber mein »Ich« entwickelt sich auch weiter durch die Erfahrungen, die ich durch meine Arbeit mache. Ohne diese Art von Arbeit möchte ich tatsächlich nicht sein. Gerne in einem gesunden Maß (wie schwer das ist …), aber doch: Ohne Arbeit, wie sie oben beschrieben ist, möchte ich mir mein Leben nicht vorstellen!
Während wir diesen Text schreiben, rücken die Sommerferien in greifbare Nähe – und damit auch FREIRÄUME! Weil die Kurse ruhen und es weniger Termindruck gibt, aber natürlich auch, weil Urlaub wartet. Diese Freiräume sind wie notwendige Antagonisten:
Ja, ich schöpfe viel Kraft und Lust aus meiner Arbeit, aber sie kostet mich auch Kraft. Die Freiräume, unverfügt, geben mir die Möglichkeit zu spüren, dass ich einfach BIN, bedingungslos – auch ohne Arbeit.
Wie erfährst du diese Frei-Räume? Schaffst du sie dir? Wann? Wie?
MH: »Freiräume«, denke ich, könnte man mit »Sabbat« übersetzen. Sabbat als der Höhepunkt der Schöpfung – und ein Tag der Freiheit! Hast du mal Abraham Heschels Buch über den Sabbat gelesen? Er deutet den Sabbat als Bild der zukünftigen Welt und des Paradieses, beides fließt ineinander. Ein Siebtel unseres Lebens könnten wir wie im Paradies leben! Tja, könnten. Tun wir‘s? Ich kann besser über den Sabbat theoretisieren, als ihn zu praktizieren. Ich würde aber gerne eine Sabbat-Kultur leben, anstatt nur über sie zu reden. Das wäre doch ein toller Vorsatz für das kommende Schuljahr – der gleiche wie seit Jahren.
Aber ja, ich schaffe mir durchaus Freiräume. Und auch da erlebe ich die Form unseres Arbeitens als privilegiert. Zwar arbeite ich oft auch abends (oder frühmorgens), wenn ich Ruhe zum Schreiben oder Nachdenken brauche, aber dafür kann ich mitten am Tag laufen gehen, wenn ich es brauche, oder mich um meinen Haushalt kümmern, wenn es notwendig ist. Freiräume schaffe ich mir auch dadurch, dass ich in andere Welten eintauche, indem ich lese …, und zwar Literatur, die nichts mit meiner konkreten Arbeit zu tun hat. Als Kind bin ich ganze Nachmittage lang »abgetaucht«, jetzt nur noch sporadisch. Aber es gelingt noch und macht mich froh.
Und wir haben Freiräume in unserer Arbeit. Ich erlebe das als großen Vertrauensvorschuss. Wie wir unsere Kurse und Fortbildungen gestalten, verantworten wir selbst. Ich (und du vermutlich auch) kann Themen einspielen, die mir wichtig sind. Ich kann ganze Arbeitstage damit verbringen, mich in neue Gebiete einzulesen, Menschen zu befragen, mich über neue Erkenntnisse auszutauschen – das sind kostbare Freiräume.
Aber manchmal quält mich die Frage, ob das, was wir arbeiten, auch künftig noch gebraucht werden wird. Wir arbeiten für eine Kirche, die von immer weniger Menschen als notwendig angesehen wird. Menschen kommen auch ohne uns klar. Was machen die aktuellen Kirchenaustrittszahlen mit dir?
UM: Danke für deine Buchempfehlung! Damit kann ich gut an deine letzten Fragen anknüpfen, denn: Ist es angesichts der Entwicklung unserer Kirche(n) wirklich angebracht, Sabbat zu halten? Oder sollten wir nicht eher nicht mehr ruhen, sondern neue Formate erfinden, zu den Menschen gehen, Schwellen senken, fluide werden, uns ins Gemeinwesen einbringen, diakonisch tätig sein … Hier höre ich mal auf, obwohl die Aufzählung von Möglichkeiten oder auch Notwendigkeiten an dieser Stelle bei weitem noch nicht beendet ist. Aber ich werde atemlos davon. Einem Ideal hinterherzujagen – einer wachsenden Kirche für Alt und Jung, Zugezogene und Immerschondagewesene, Nahe und Ferne. Natürlich erschrecken mich die schrumpfenden Mitgliederzahlen und die Perspektiven, die sich damit verbinden, denn sie stellen für mich auch ganz persönlich die Frage, ob ich meine (eben so sehr geschätzte) Arbeit eigentlich bis zum Ruhestand werde tun können. Und was wird eigentlich mit der Qualität der Arbeit, wenn wir uns vielleicht in naher Zukunft keine eigenen Ausbildungen/Studiengänge/Weiterbildungen mehr werden leisten können als Kirche? Denn dafür stehen wir doch auch, darum ringen wir doch auch so oft: Um eine erlebbar gute Qualität unserer Arbeit!
Dann hilft mir manchmal das Bild vom Lagerfeuer. Kirche als Ort, wo ein Feuer brennt für die »gute Botschaft«, wo Menschen genau das miteinander teilen, wo sie näher kommen oder auch in ein wenig Distanz bleiben können, aber wo das Feuer auf JEDEN FALL weiterbrennt. Dieses Feuer hüten – das muss ich, Gott sei Dank, nicht allein. Insofern: Es darf auch weiterhin Sabbat-Zeiten geben. Muss es sogar.
MH: Sabbat heißt ja auch: darauf zu vertrauen, dass Gott das Werk seiner Hände nicht preisgibt – auch in den Zeiten, die meine Freiräume zum Ausruhen sind. Gott ist da, auch wenn ich schlafe. Ein guter Gedanke! Also lass uns weiter arbeiten und ab und an ausruhen. Beides ist notwendig, damit das Lagerfeuer weiter brennt. Wie Du gesagt hast: das Feuer hüten, das muss ich, Gott sei Dank, nicht alleine. Ich nicht und Du auch nicht. Wir haben einander. Das wäre übrigens eine gute Definition von »Kolleg:innen«: Menschen, die miteinander arbeiten und einander Freiräume geben!
UM: Und manchmal einfach nebeneinander am Feuer sitzen – still und versonnen, singend, lachend, feiernd. Ich freu mich darauf.

Dieser Artikel ist Teil des AKD-Arbeitsberichts 2023/2024.
Foto: Laura Otýpková – Pixabay